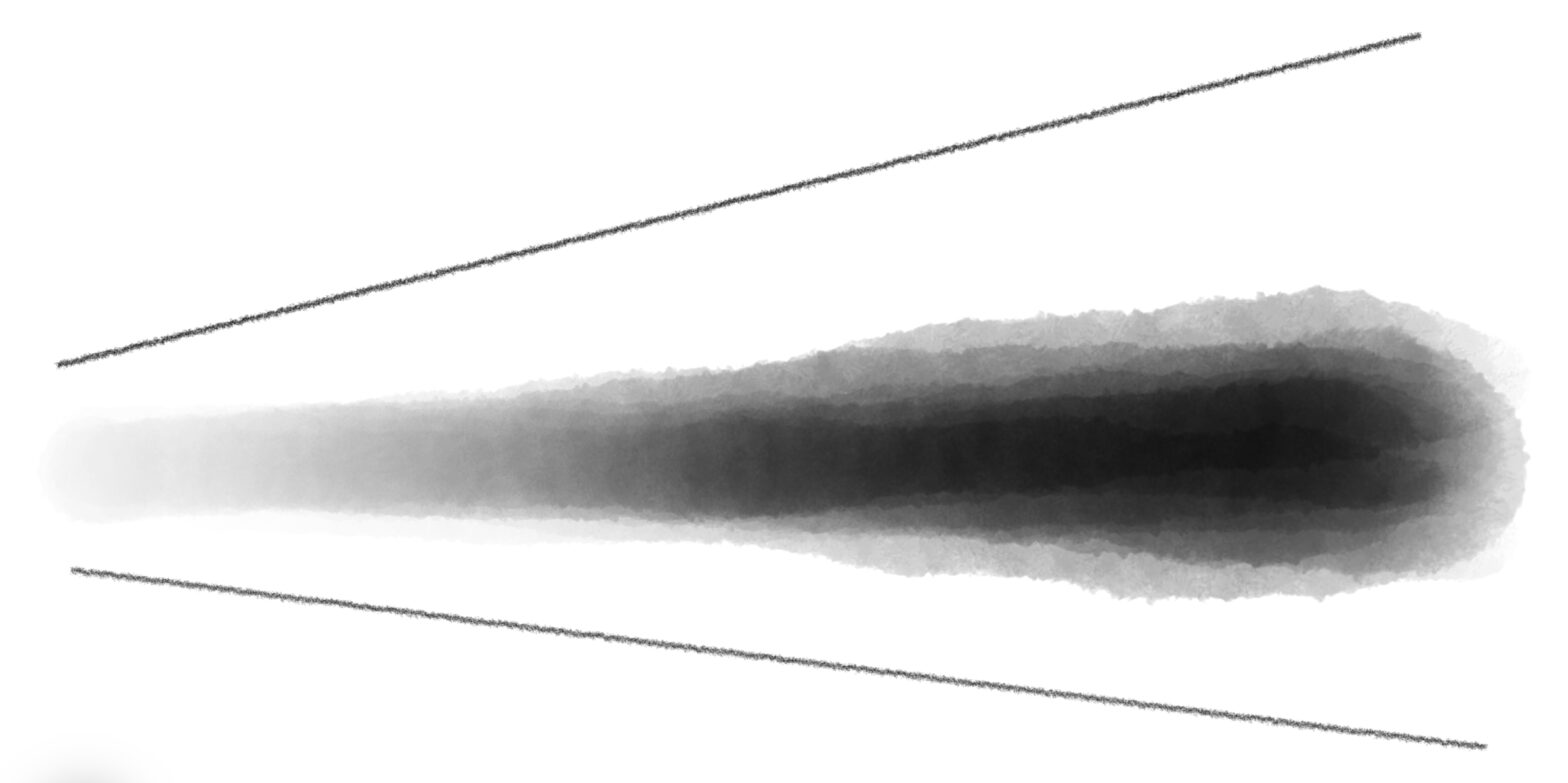Welche Konsequenzen ergeben sich für die Didaktik, wenn wir das „Zentrum“ als dynamisch und weit verstehen? Teil drei meiner kleinen Serie zu einem fundamentalen Prinzip des Aikido.
In den vorigen beiden Beiträgen habe ich ein enges-statisches von einem weiten-dynamischen Zentrum unterschieden und dargelegt, wie sich dies auf unser Verständnis vom Körper auswirkt (falls noch nicht gelesen, geht es hier und hier zu den jeweiligen Beiträgen).
Was lässt sich nun aus dieser grundlegenden Unterscheidung der beiden Arten, das Zentrum zu denken, für die Aikido-Didaktik ableiten?
In meinem Beitrag „Ein geformter Körper: Aikido als Bewegungskunst“ hatte ich dies bereits angedeutet. Die dort vorgeschlagenen vier Basis-Übungen – das Aushängen, die natürliche Hocke, die diagonale Dehnung (diagonal stretch) und die Mobilisierung der Wirbelsäule (spinal waves) – basieren nämlich auf der Überlegung einer extremen Mitte. Je entspannter ich hängen (maximale vertikale Ausdehnung), hocken (maximale Kompaktheit), mich diagonal in eine Extremposition begeben kann und je freier meine Wirbelsäule ist, desto leichter, lockerer und offener wird beispielsweise eine der idealtypischen Haltungen: das Stehen.
Warum?
Das einfache Stehen (analog ließe sich dies für die Aikido Grundposition hanmi zeigen) ist ja keine in sich geschlossene Haltung. Vielmehr ist das Stehen ein Balanceakt zahlreicher Muskeln. Wie voraussetzungsvoll diese Balance ist, wird klar, wenn man sich den mühsamen „Trainings-Weg“ eines Kindes ansieht, bis es endlich das erste Mal stehen kann.
Diesen Gedanken möchte ich im Folgenden entlang zweier Facetten vertiefen: das Üben von Extremen und das Üben in heterogenen Kontexten.
Inhalt
Sich von Extremen her nähern
Woher sollen wir zu Beginn wissen, was es heißt, zentriert zu sein oder die richtige Körperspannung aufzubauen?
Diese Frage wurde mir das erste mal bewusst, als ich vor Jahren auf einem Lehrgang von Patrick Cassidy Sensei war. Bei einer Schwertübung gab er einem Teilnehmer, der neben mir stand, den Hinweis, völlig entspannt das bokken (Holzschwert) zu heben und nach unten zu führen.
Mein Nachbar antworte: „Aber dann bin ich doch viel zu locker!“ Darauf erwiderte Patrick Cassidy, es gebe zwei Möglichkeiten: Entweder sich peu a peu der richtigen Balance anzunähern – oder aber auf die andere Seite der Skala zu springen und dann zu schauen, ob man sich so nicht leichter der goldenen Mitte nähern könne.
Man kann letzteres auch „Experimentalismus“ nennen, wie es der amerikanische Philosoph John Dewey versteht. Dieser Experimentalismus lässt sich mit den den Worten von Markus Holzinger so bestimmen:
„Deweys Experimentalismus besagt, dass die Qualität von Erfahrungen dann erkenntnisstiftend wird, wenn Erfahrungsdifferenzen erzeugt werden….“ (S. 19) (Quelle)
Diese Methode der Erzeugung von Erfahrungsdifferenzen scheint mir ein sehr vielversprechender didaktischer Ansatz zu sein. Statt scheinbare Abweichungen von der gesuchten und sehr häufig nur fiktiven Mitte als „Fehler“ oder „Spielerei“ zu verstehen, kann man sie auch als konstitutiven Moment für die Etablierung des Zentrums auffassen.
Der didaktische Weg hin zum Ziel ist also nicht geradlinig, steif oder verbohrt, sondern spielerisch, experimentell, ausprobierend. Erst wenn wir etwa den Unterschied von Anspannung und Lockerheit erfahren, können wir langsam eine innere Skala entwickeln und nach und nach verfeinern. Und so können wir irgendwann auch erkennen, wenn wir eine gute Balance haben zwischen Anspannung und Entspannung.
Ein weiteres Beispiel könnte die Funktion der Grundschule (kihon waza) im Training sein. Ich bin zwar ein großer Fan von einer gründlichen, recht statischen Grundschule. Aber – wie beim obigen Beispiel der Entspannung – glaube ich nicht, dass sich daraus die fließende Form (awase) ohne weiteres ergibt, die sowohl flexibel als auch stabil ist.
Von dem Ideal der weiten Mitte ausgehend, halte ich es daher für angebracht, auch freie, spielerische Übungsformen im Training zu integrieren. So können produktive Erfahrungsdifferenzen entstehen, die das Ziel – ein freies und fließendes Aikido – wahrscheinlicher machen.
Kontexte erweitern
In der movement culture gibt es ein didaktischen Dreischritt, der dem Tanzen entlehnt ist: Isolation, Integration, Improvisation.
Um eine körperliche Fähigkeit zu erlernen, hilft es, als erstes die dafür relevanten Bewegungsmuster zu zergliedern und unter den einfachsten Bedingungen zu üben. Beispielsweise sollten wir die Anbindung der Schultern üben (Isolation), bevor wir dieses Muster dann für einen Klimmzug nutzen (Integration). Davon ausgehend können wir immer weitere Bewegungen mit den Händen über den Kopf ausprobieren. Das interessante daran ist nun: Die Schulteranbindung wird immer stabiler, je heterogener die Bewegungen in dieser letzten Improvisationsphase werden.
Die Parallelen zum Aikido liegen auf der Hand: Wollen wir etwa eine Hebeltechnik lernen, so macht es natürlich am Anfang Sinn, diese sehr vereinfacht und isoliert zu üben und dabei das Zentrum nicht zu verlieren. Danach können wir uns dann darauf fokussieren, vor, während und nach der Technik zentriert zu sein. Allerdings können wir daraus nicht ableiten, dass ebenso zentriert sind, wenn wir in anderen Kontexten die Technik ausüben: anderer Untergrund, andere Kleidung, andere Partner, andere Trainingssituation (z.B. beim randori, der Übungsform mit freien Angriffen und Techniken) usw.
Hier kommt nun also eine weitere Ebene des dynamischen-weiten Zentrums ins Spiel. Wir sind, so möchte ich behaupten, umso zentrierter, je vielfältiger die Bedingungen und Kontexte sind, in den wir unser Zentrum bewähren müssen. Oder andersherum formuliert: Je dynamischer und weiter das Zentrum, in desto mehr Kontexten kann es etabliert werden.
Das klingt vielleicht sehr breit und abstrakt, kann aber auch sehr konkret sein: verschiedene Übungsformen und Übungspartner (was in den meisten Aikido-Dojos ohnehin praktiziert wird), das Üben mit Menschen aus anderen Aikido-Stilen und Kampfkünsten, das Üben in ungewohnten Gegenden, zu ungewohnten Uhrzeiten usw.
Monotonie und Abwechslung
Die Leitidee einer dynamisch-weiten Mitte hat, wie ich gezeigt habe, konkrete Auswirkungen darauf, wie wir Aikido üben. All das heißt nicht, dass die Wiederholung, die Isolierung oder die Grundschule weniger wichtig wären. Ich denke lediglich, sie sollten systematisch und frühzeitig um die andere Seite der Medaille ergänzt werden.
Von dieser Warte aus betrachtet wären auch spielerische, explorative Elemente dem Aikido-Training nicht äußerlich, sondern sollten vielmehr elementarer Bestandteil des Trainings sein. Vielleicht ist dies auch ein ganz praktisches Mittel gegen die von mir an anderer Stelle beschriebene Krise des Aikido: Das Training macht einfach mehr Spaß!